Crowd Investing zählt zu den modernen Varianten der Startup-Finanzierung. Bei dieser form des Investments unterstützen Privatanleger mit ihrem Geld junge, innovative Firmen. Im Gegenzug steht ihnen eine finanzielle Beteiligung an deren Wachstum zu. Das vom Bundeskabinett beschlossene Kleinanlegerschutzgesetz setzt sich zum Ziel, Kleinanleger bei Investitionen besser zu schützen. Die Ausnahmen für Crowdfinanzierung reichen aus Sicht des Digitalverbands BITKOM nicht aus, um Startups zu finanzieren und Crowdinvestoren mehr Spielraum bei ihren Geldern einzuräumen.
Eine überwältigende Mehrheit der beteiligten Nutzer (98 Prozent) sind sich als Investoren des Risikos ihrer Geldanlage bis zum Totalverlust bewusst, weil die zu finanzierenden Projekte ihrer Meinung nach transparenter vorgestellt werden (90 Prozent). Laut einer Umfrage durch den BITKOM unter 133 Privatanlegern hält die Mehrheit eine Regulierung durch die Politik für überflüssig. Das neue Kleinanlegerschutzgesetz würde sogar viele Nutzer von Crowd-Investing-Plattformen vertreiben. Mit dem Eingreifen der Politik kommt schnell das finanzielle Aus für zahlreiche Startup-Projekte, die keine Finanzierung durch klassische Geldgeber wie Business Angels oder Venture-Capital-Geber überzeugen können. Sechs von zehn Kleinanlegern (62 Prozent) halten sich bei Crowd Investing sogar für besser informiert als bei klassischen Investitionen durch Banken. Nur 8 Prozent fühlen sich schlechter informiert. Fast jeder Crowdinvestor (95 Prozent) möchte auch künftig einen Teil seines Geldes auf diese Weise investieren.

Crowd Investment gilt als eine clevere Möglichkeit, innovative Startup-Projekte durch Privatanleger zu finanzieren. Das Bundeskabinett findet das gar nicht gut und möchte den Bürger vor sich selbst schützen.
„Die Zahlen belegen eindeutig: Es ist nicht notwendig, Crowd Investing in Deutschland stärker zu reglementieren. Die im Kleinanlegerschutzgesetz vorgesehenen bürokratischen Regelungen sind überflüssig und würden Crowd Investing in Deutschland nur unattraktiv machen“, sagt BITKOM-Vizepräsident Ulrich Dietz.
So gelten die Ausnahmen nur bis zu einer Gesamtfinanzierungsumme von 1 Million Euro. Einzelinvestoren dürfen sich nur mit 1.000 Euro beteiligen, eine Obergrenze von maximal 10.000 Euro soll nur bei entsprechenden Vermögens- oder Einkommensnachweisen gelten. Außerdem müssen Anleger ein Informationsblatt ausdrucken und dies unterschrieben an die Crowd-Investing-Plattform zurücksenden. Zudem dürfen sie ebenso wie die Startups selbst nur sehr beschränkt im Internet um Investoren werben.

Ulrich Dietz, Vizepräsident des BITKOM. Quelle: BITKOM
„Alle diese neuen Vorschriften verbessern die Finanzierungssituation von Start-ups nicht, sondern es würde hierzulande schwerer, Geld bei Kleinanlegern einzusammeln“, kritisiert Ulrich Dietz und betont: „Crowd Investing muss von den bürokratischen Regelungen des Kleinanlegerschutzgesetzes in deutlich größerem Umfang als bisher vorgesehen ausgenommen werden. Das geplante Kleinanlegerschutzgesetz macht Crowd Investing bürokratisch, langsam und unattraktiv. Bundesrat und Bundestag sind jetzt aufgerufen, diese überflüssigen Änderungen zu stoppen.“
Drei Viertel der privaten Investoren (74 Prozent) geben an, dass sie ihre Einkommensverhältnisse gegenüber der Plattform oder dem Start-up nicht offenlegen. Ihr maximales Investment beträgt damit künftig 1000 Euro pro Projekt oder Startup. Nur 12 Prozent der Crowdinvestoren wären zu dieser Offenlegung bereit. Etwa jeder Dritte (37 Prozent) der Investoren hat zumindest in der Vergangenheit bereits Summen von mehr als 1000 Euro investiert.
Mehr als 10.000 Euro haben bereits 5 Prozent aller Befragten schon einmal für ein einzelnes Investment eingesetzt. Nur jeder Vierte (26 Prozent) wäre bereit, das vorgeschriebene Informationsblatt auszudrucken und unterschrieben zurückzusenden. Jeder Zweite (48 Prozent) hält diesen Vorgang für zu aufwändig und 17 Prozent wären dazu gar nicht in der Lage, weil sie nach eigener Angabe überhaupt keinen Drucker besitzen würden.

Florian Nöll, Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Deutsche Startups (BVDS) e.V. Quelle: Felix Müller / BVDS
Crowd Investment ist eine Art der Anlageform und Firmenfinanzierung, bei der Kapitalbedarf von Unternehmen durch private Mikroinvestoren gedeckt wird. Damit stellt Crowd Investing eine einzigartige Form der Unterstützung für kleine Projekte dar, welche nicht auf mehrere Millionen, sondern eine grundsolide Finanzierung zur Realisierung von Projekten angewiesen sind.
Bereits im September 2014 begrüßte der Bundesverband Deutsche Startups (BVDS) e.V. den ursprünglichen Gesetzentwurf, forderte jedoch schon damals deutlich mehr Arbeit in das Kleinanlegerschutzgesetz zu stecken. Florian Nöll, Vorsitzender des BVDS, kritisierte, „dass der Gesetzgeber mit Blick auf die Realität der Startupfinanzierung durch die Crowd noch nachbessern muss. Startups brauchen die Finanzierung durch die Crowd und es ist ein schmaler Grat zwischen sinnvollem Anlegerschutz und einer Todregulierung dieses innovativen Finanzierungsinstruments.“ Bei der Regulierung sollten insbesondere die Interessen der Startups berücksichtigt werden, was jedoch immer noch nicht in der aktuellen Vorlage erfolgt ist.





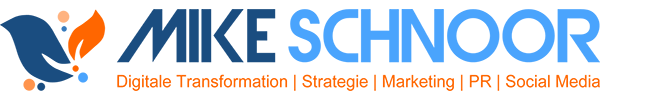
Social Media und Werbung üben kaum Einfluss auf Reputation von Banken aus
FinTech, Social MediaSeriösität, Sicherheit und Glaubwürdigkeit zählen bei Finanzthemen zu den Grundgedanken der Kommunikation. Die Berichterstattung in TV, Radio und Print hilft Banken bei der Reputationssteigerung, so dass die klassische Pressearbeit für die Finanzhäuser die wichtigste Rolle im Kommunikationsmix übernimmt. Die Kommunikation in sozialen Netzwerken hingegen wirkt sich deutlich weniger auf die Reputation von Banken und Finanzinstituten aus. Zu diesem Schluss kommt eine Untersuchung von TNS Infratest unter 1.006 finanzaffinen Personen in Deutschland, Schweiz, Großbritannien, USA und Singapur.
Diese Entwicklung dürfte den Social Media Managern in der Finanzwelt weit weniger gefallen als den Entscheidern in der Unternehmenskommunikation. Gerade auf dem deutschen Finanzmarkt haben nach wie vor die Medien als wichtigste Informationsquelle um Reputation von Banken die Oberhand, gefolgt von persönlichen Empfehlungen von Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern. Vertrauen in Empfehlungen und die Erfahrung mit Bankgeschäften und Finanzthemen spielen dabei zusätzliche Pluspunkte aus, so dass vor allem die jüngere Zielgruppe der 18- bis 25-Jährigen vornehmlich auf diese beiden Informationsquellen vertraut.
Die Kommunikation in den sozialen Medien bleibt hingegen für die Verbraucher weit weniger relevant. Erst mit deutlichem Abstand folgen soziale Medien, obwohl die Nutzung von Blogs, Online-Foren und sozialen Netzwerken die Gespräche über Banken und Finanzprodukte intensivieren. Auf dem hinteren Platz findet sich die reine Werbung wieder, die zumindest für deutsche Verbraucher kaum eine Relevanz mehr besitzt. Das veränderte Medienkonsumverhalten, das Desinteresse an Werbeinseln im laufenden Programm, das Sondieren von Nachrichtenmedien sowie die Sensibilisierung für Online-Werbung und der Einsatz von AdBlocker-Software tun ihr übriges.
Im internationalen Vergleich haben persönliche Empfehlungen einen höheren Stellenwert als die Berichterstattung in klassischen Medien, während sich die Online-Präsenzen der Banken in Social Media wiederum vor allgemeinen Werbemaßnahmen einfinden. Insgesamt betrachtet zeigt die Untersuchung, dass das Engagement von Banken und Finanzinstituten im digitalen Bereich noch sehr viel Arbeit für die Reputation leisten muss, bevor Social Media Manager auf Augenhöhe mit der PR-Abteilung ankommen.
Relevanz von Informationskanälen im internationalen Vergleich. Quelle: TNS Infratest
Videostreaming sorgt für 241 Millionen Euro Werbeumsatz in 2014
Bewegtbild, Digital Business, WerbungDas wird Videoportale erfreuen: Der Werbeumsatz im direkten Umfeld von Videostreaming betrug in Deutschland im vergangenen Jahr rund 241 Millionen Euro. Damit wächst der Markt für Bewegtbildwerbung um 17 Prozent. Zu diesem Schluss kommt Digitalverband BITKOM anhand einer Datenauswertung durch das Marktforschungsunternehmen IHS Technology.
Als Insel betrachtet wirkt der Werbemarkt für Bewegtbild im Netz noch relativ klein, wenn Vergleiche zum traditionellen Fernsehen gezogen werden. Der BITKOM geht jedoch auch in den kommenden Jahren weiter von zweistelligen Wachstumszahlen aus und rechnet im laufenden Jahr erneut einen Anstieg um 16 Prozent auf 278 Millionen Euro. Schließlich konsumieren fast drei Viertel (73 Prozent) der Internetnutzer in Deutschland mittlerweile ihre gewünschten Videoinhalte per Streaming.
„Videostreaming entwickelt sich zu einem lukrativen Markt mit hochwertigen Inhalten, innovativen Erlösmodellen und eigenen Werbeformaten“, sagt BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder.
Damit hat der BITKOM durchaus Recht, jedoch stellt sich die Frage, welche Werbeformen genau für die Berechnung der Vorjahreswerte und der aktuellen Prognostik zugrunde gelegt wurden. Wurden ausschließlich die Netto-Werbeinvestitionen, also ohne jegliche Vermarkter- und Mediaagenturrabatte berücksichtigt? Oder flossen die Bruttowerte nach Preistabelle direkt in die Bewertung ein?
Bereits ähnliche Wachstumswerte bezifferte der Online-Vermarkterkreis (OVK) im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) schon vor rund einem Jahr anhand des bekannten Jahresvergleichs im OVK-Report. Damals konnten die Bruttoinvestitionen in Bewegtbildformate um 28 Prozent von 2012 zu 2013 steigen. Nach der OVK-Werbestatistik aus dem letzten September wurden sogar insgesamt 121 Millionen Euro brutto mit Pre-Roll-Video-Ads allein in den ersten Monaten in 2014 umgesetzt.
Das Ranking der Top-10-Online-Werbeformen
Hinzu gesellen sich im Segment der InStream-Ads noch Mid-Rolls und Post-Rolls sowie die volle Bandbreite von InPage-Advertising, die nicht nur innerhalb des direkten Umfelds nahe der Videoplayer, sondern in jedwedem Content-Bereich ausgesteuert werden können.
Hilfreich für die Einordnung von Digital Advertising, speziell für Bewegtbild-Werbung, wäre die exakte Klassifizierung und direkte statistische Auswertung der Werbemaßnahmen und Umfelder. Ein kleiner Kraftakt, der die Transparenz am Bewegtbildmarkt jedoch immens erhöhen könnte. Obendrein wäre eine Segmentierung der Inhalte nach den Portalen interessant, auf denen Videos konsumiert werden. Dazu zählen nicht nur YouTube, Telekom, MyVideo & Co., sondern die verschiedenen Anbieter von erotischen und pornografischen Videos. Dies scheinen sämtliche Statistiken und Prognosen gerne auszublenden, obwohl die etwas schlüpfrigeren Videoportale sich mit sehr viel einschlägiger Umfeldwerbung refinanzieren.
Infografiken in der PR: 10 Tipps für den Erfolg mit dem richtigen Bildmaterial
Marketing, Medien, Public RelationsInfografiken zählen zum PR-Alltag dazu wie das geschriebene Wort. Zumindest möchte man davon ausgehen, weil sich unser Informationskonsum immer stärker in Richtung Bild und Video verlagert. Ohne Text geht natürlich kaum etwas. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit steht vor der Herausforderung, nicht mehr ausschließlich für Journalisten, sondern direkt für Endkunden bzw. Endnutzer den Content zu erstellen. Doch worauf kommt es dabei wirklich an?
Weiterlesen
Internetnutzer meiden Digitale Services von Banken, Versicherungen und Telefonanbietern
FinTech, Social MediaFür die deutschen Internetnutzer haben sich soziale Medien in der privaten Kommunikation fest etabliert. Vor dem Kontakt mit Banken, Versicherern oder dem Internetprovider jedoch scheuen sie sich. Nur 29 Prozent der Deutschen nutzen Facebook, Twitter und Co., um aktiven Kundensupport in Anspruch zu nehmen oder um Hilfe zu erhalten. Stattdessen greifen selbst digital-affine Nutzer lieber zu Telefon, E-Mail und Brief. Für den Kontakt mit Freunden, Familie und Bekannten nutzen hingegen 83 Prozent Social Media. Zu diesem Ergebnis kommt der „Social Media Atlas 2014/2015“ von der Hamburger Kommunikationsberatung Faktenkontor, für die 3.450 Internetnutzer ab 14 Jahren zu ihrer Social-Media-Nutzung befragt wurden.
Zwar sorgen Smartphones für eine hohe Verdichtung der Kommunikation über soziale Netzwerke, aber die Social-Media-Nutzer bevorzugen mit ihren Dienstleistern zu telefonieren, anstatt Statusmeldungen an deren Online-Präsenzen zu schicken. Insgesamt 92 Prozent der Web-2.0-Nutzer nutzen das Telefon, 47 Prozent von ihnen tun dies sogar häufig.
„Die geringe Nutzung ist sicherlich auf zwei Effekte zurückzuführen“, meint Dr. Roland Heintze, geschäftsführender Gesellschafter der Faktenkontor GmbH. „Zum einen sind gute Social Media-Angebote im Dienstleistungssektor auch heute noch eher selten zu finden, gerade bei Banken und Versicherern. Zum anderen bevorzugen hier auch Web 2.0-affine Kunden häufig den persönlichen Kontakt auf herkömmlichen Wegen.“
Soziale Netzwerke liegen weit hinter klassischen Kommunikationsformen für den Kontakt mit Dienstleistern. Quelle: Faktenkontor GmbH.
Sowohl E-Mails als auch „echte“ Briefe setzen die Social-Media-Nutzer häufiger für den Kontakt zum Dienstleister ein als Twitter und Facebook. Die überwiegende Mehrheit (90 Prozent) nutzt E-Mails und 75 Prozent schreiben Briefe. Letztere Zahl spricht für das Kommunikationsverhalten, sobald es sich um vertragsrelevante Inhalte wie Verlängerungen, Anpassungen und Kündigungen handelt. Die Gewissheit, dass eine Kündigung per Tweet oder Facebook meist nicht wirksam ist, scheint in der Gesellschaft angekommen zu sein.
Sobald etwas nicht funktioniert, z.B. das Mobilnetz ausfällt, kommt scheinbar der Frust hervor. So nehmen fünf Prozent der befragten Social-Media-Nutzer über die sozialen Medien häufig Kontakt zu Dienstleistungsunternehmen auf, zehn Prozent geben an, dies manchmal zu tun und weitere 14 Prozent selten. Mehr als zwei Drittel kommunizieren nie über soziale Medien mit Dienstleistern aus Banken, Versicherungen und Telefonanbietern.
Gerade die sensiblen Daten im Finanzwesen sprechen für viele Deutsche gegen die öffentliche Kommunikation über private Belange. Social Media gilt vielmehr als Hilfsmittel im Fall des Kundensupports, sofern die Dienstleister auch mit einer digitalen Präsenz zu den relevanten Zeiten des Kundensupports erreichbar sind. Ein einfacher Pressestellen-Account zur Distribution von News reicht nicht aus. Bei vielen kleineren Banken und Versicherern, die nicht eine Rundumbetreuung gewährleisten, überwiegen noch Aufwand und Kosten gegenüber dem Vorteilsgedanken für die eigenen Kunden. Immerhin erhält man bei vielen Telefonanbietern direkte Unterstützung auf Facebook und Twitter. In den vielen Fällen wird jedoch auf E-Mail umgeleitet, sobald es um sensible Kundendaten geht. Somit vermischt sich die Kommunikation der deutschen Internetnutzer sehr oft, was keine klare Trennung zulässt, jedoch zumindest für künftige Studien ein aufschlussreiches Feld für weitere Untersuchungen liefern kann.
Content Marketing Conference: Vom Buzzword zum Mekka für die Digitalbranche
Digital Business, Events, Marketing, Social Media, WerbungContent Marketing zählt zu den schönsten Buzzwörtern des vergangenen Jahres. Unter der Haube steckt natürlich viel Wrumms, denn zahlreiche Agenturen, Berater und Unternehmen sprechen fast ausschließlich von den Inhalten, die Kunden und Nutzer begeistern sollen. Zu diesem Themenstrang der Digitalen Wirtschaft findet am 4. und 5. März in Köln die Content Marketing Conference statt, auf der renommierte Experten ihre Best-Practice-Cases vorstellen. Dabei tauschen sie sich über die wichtigsten Faktoren für die Erarbeitung und Umsetzung einer Content-Marketing-Strategie aus. Zusätzlich erhalten Besucher einen Einblick in Native Advertising und Paid Media sowie deren Zusammenspiel mit Content Marketing. Gepaart mit Strategieentwicklung, SEO im Content Marketing und Corporate Blogs trifft sich hier die Digitalbranche zum Happening am Rhein.
Die Besucher der letzten CMC. Quelle: Contilla.
„Content-Marketing als Kommunikationsdisziplin als auch die Dienstleistungen und Tools haben sich in den letzten zwei, drei Jahren mannigfaltig weiterentwickelt: Vom Marketing-Hype zu der meistfokussierten Maßnahme im Online-Marketing-Mix. Im März 2015 wollen wir wieder die Plattform für die Branche stellen, die einen Überblick über den Status Quo verschafft und zukünftige Trends setzt“, so René Kühn, Initiator der CMC und Geschäftsführer beim Veranstalter Contilla.
Insgesamt 15 Vorträge und 6 Workshops laden zu Diskussionen ein. Auf der Bühne sorgen Andreas Neef (L’Oréal), Will Hayward (BuzzFeed), Thomas Knüwer (kpunktnull), Thomas Berger (Toyota), Michael Göntgens (Lufthansa), Svea Raßmus (Deutsche Bahn), Daniel Holm (Outbrain), Jürgen Schmidt (Contented Technologies GmbH), Jan Kutschera (PR – Popularity Reference GmbH) und Christian Herr (iq digital) für genügend Zündstoff. Darüber hinaus gibt es das bekannte Speednetworking, einen Expobereich für Aussteller und eine Networkparty. Weiterführende Informationen und Tickets gibt es auf der offiziellen Veranstaltungsseite.
In eigener Sache: Der #DigiBuzz Bullshit Bingo Generator
Digital Business, Social Media[xyz-ips snippet=“DigiBuzz-Bullshit-Bingo“]
Neue Buzzwords gefällig? Einfach neu laden!
Die Digitale Wirtschaft lebt von Fachbegriffen, Hypes und Buzzwords. Vieles davon macht Sinn, manches hingegen wirkt auf eingefleischte Branchenkenner eher belustigend.
Der #DigiBuzz Bullshit Bingo Generator nutzt die besten Buzzwords der Digitalbranche und liefert immer eine neue, druckfertige Vorlage zum Bullshit Bingo! Viel Spaß damit auf Konferenzen, Events und Parties!
Was ist Bullshit Bingo?
Laut der Wikipedia liest sich die Definition wie folgt:
Vielen Dank für die Mithilfe der kreativen Köpfe, die allesamt ihren Beitrag zur Wortfindung und damit zur Datengrundlage für den #DigiBuzz Bullshit Bingo Generator geleistet haben!
@bindermichi, @bjoernkorff, @boydroid, @christinah84, @derlarshahn, @dingler_g4, @doschu, @einfachbens, @freizeichen20, @getoliverleon, @heiko, @hermannassmann, @herrsteller, @jakuuub, @janpiatkowski, @kehrseite, @klauseck, @kochsmicha, @kprobiesch, @MaelRothDE, @manumarron, @marco_jahn, @mattgey_annette, @mediamoda, @mikeschnoor, @mmotu, @netzmilieu, @nico, @oetting, @oliverg, @penzonator, @pr_doktor, @skykat, @stivologne, @svensonsan, @thehartworker, @tristessedeluxe, @ulrike_r, @vielweib, @walljet, Martin S. und Sebastian S.
Hinweis: Dieses Tool ist nicht für die Darstellung auf mobilen Endgeräten optimiert. Bei Problemen mit der Druckansicht freuen wir uns über einen Hinweis in den Kommentaren inkl. Link zum Screenshot/Foto mit dem Fehler.
Mehrheit der Privatanleger lehnt neue Regeln beim Crowd Investing ab
Digital Business, Netzpolitik, Recht, StartupsCrowd Investing zählt zu den modernen Varianten der Startup-Finanzierung. Bei dieser form des Investments unterstützen Privatanleger mit ihrem Geld junge, innovative Firmen. Im Gegenzug steht ihnen eine finanzielle Beteiligung an deren Wachstum zu. Das vom Bundeskabinett beschlossene Kleinanlegerschutzgesetz setzt sich zum Ziel, Kleinanleger bei Investitionen besser zu schützen. Die Ausnahmen für Crowdfinanzierung reichen aus Sicht des Digitalverbands BITKOM nicht aus, um Startups zu finanzieren und Crowdinvestoren mehr Spielraum bei ihren Geldern einzuräumen.
Eine überwältigende Mehrheit der beteiligten Nutzer (98 Prozent) sind sich als Investoren des Risikos ihrer Geldanlage bis zum Totalverlust bewusst, weil die zu finanzierenden Projekte ihrer Meinung nach transparenter vorgestellt werden (90 Prozent). Laut einer Umfrage durch den BITKOM unter 133 Privatanlegern hält die Mehrheit eine Regulierung durch die Politik für überflüssig. Das neue Kleinanlegerschutzgesetz würde sogar viele Nutzer von Crowd-Investing-Plattformen vertreiben. Mit dem Eingreifen der Politik kommt schnell das finanzielle Aus für zahlreiche Startup-Projekte, die keine Finanzierung durch klassische Geldgeber wie Business Angels oder Venture-Capital-Geber überzeugen können. Sechs von zehn Kleinanlegern (62 Prozent) halten sich bei Crowd Investing sogar für besser informiert als bei klassischen Investitionen durch Banken. Nur 8 Prozent fühlen sich schlechter informiert. Fast jeder Crowdinvestor (95 Prozent) möchte auch künftig einen Teil seines Geldes auf diese Weise investieren.
Crowd Investment gilt als eine clevere Möglichkeit, innovative Startup-Projekte durch Privatanleger zu finanzieren. Das Bundeskabinett findet das gar nicht gut und möchte den Bürger vor sich selbst schützen.
„Die Zahlen belegen eindeutig: Es ist nicht notwendig, Crowd Investing in Deutschland stärker zu reglementieren. Die im Kleinanlegerschutzgesetz vorgesehenen bürokratischen Regelungen sind überflüssig und würden Crowd Investing in Deutschland nur unattraktiv machen“, sagt BITKOM-Vizepräsident Ulrich Dietz.
So gelten die Ausnahmen nur bis zu einer Gesamtfinanzierungsumme von 1 Million Euro. Einzelinvestoren dürfen sich nur mit 1.000 Euro beteiligen, eine Obergrenze von maximal 10.000 Euro soll nur bei entsprechenden Vermögens- oder Einkommensnachweisen gelten. Außerdem müssen Anleger ein Informationsblatt ausdrucken und dies unterschrieben an die Crowd-Investing-Plattform zurücksenden. Zudem dürfen sie ebenso wie die Startups selbst nur sehr beschränkt im Internet um Investoren werben.
Ulrich Dietz, Vizepräsident des BITKOM. Quelle: BITKOM
Drei Viertel der privaten Investoren (74 Prozent) geben an, dass sie ihre Einkommensverhältnisse gegenüber der Plattform oder dem Start-up nicht offenlegen. Ihr maximales Investment beträgt damit künftig 1000 Euro pro Projekt oder Startup. Nur 12 Prozent der Crowdinvestoren wären zu dieser Offenlegung bereit. Etwa jeder Dritte (37 Prozent) der Investoren hat zumindest in der Vergangenheit bereits Summen von mehr als 1000 Euro investiert.
Mehr als 10.000 Euro haben bereits 5 Prozent aller Befragten schon einmal für ein einzelnes Investment eingesetzt. Nur jeder Vierte (26 Prozent) wäre bereit, das vorgeschriebene Informationsblatt auszudrucken und unterschrieben zurückzusenden. Jeder Zweite (48 Prozent) hält diesen Vorgang für zu aufwändig und 17 Prozent wären dazu gar nicht in der Lage, weil sie nach eigener Angabe überhaupt keinen Drucker besitzen würden.
Florian Nöll, Vorstandsvorsitzender im Bundesverband Deutsche Startups (BVDS) e.V. Quelle: Felix Müller / BVDS
Bereits im September 2014 begrüßte der Bundesverband Deutsche Startups (BVDS) e.V. den ursprünglichen Gesetzentwurf, forderte jedoch schon damals deutlich mehr Arbeit in das Kleinanlegerschutzgesetz zu stecken. Florian Nöll, Vorsitzender des BVDS, kritisierte, „dass der Gesetzgeber mit Blick auf die Realität der Startupfinanzierung durch die Crowd noch nachbessern muss. Startups brauchen die Finanzierung durch die Crowd und es ist ein schmaler Grat zwischen sinnvollem Anlegerschutz und einer Todregulierung dieses innovativen Finanzierungsinstruments.“ Bei der Regulierung sollten insbesondere die Interessen der Startups berücksichtigt werden, was jedoch immer noch nicht in der aktuellen Vorlage erfolgt ist.
7 Tipps für Online-Shops: Was ist der beste Vermarktungskanal für Sortimente?
Digital Commerce, WerbungDigitale Kanäle bieten unzählige Möglichkeiten, die Produktsortimente von Online-Shops zu vermarkten. Preissuchmaschinen, Produktportale, Affiliate Netzwerke, Retargeting-Angebote, Marktplätze, Cashback, Shopping Clubs oder Mobileâ€Angebote – diese Vielfalt ist Segen und Fluch zugleich.
Die Anzahl der Wege in den Online-Shop ist heute weitreichender denn je, so dass die Suche nach dem besten Vermarktungskanal für Online-Shops sich zur Fleißaufgabe entwickelt. Schließlich kommen fast täglich neue Portale und Werbeformate hinzu, während andere recht schnell in der Versenkung enden. Für den Kunden gehört es längst zur Gewohnheit, mehrere Informations- und Vertriebskanäle auszuprobieren, bevor die wichtige Kaufentscheidung getroffen wird.
Die Vielfalt macht es jedoch möglich, dass fast jede Produktkategorie mittels geeigneten Platzierungsmöglichkeiten beworben werden kann. Hingegen kann es selbst dem professionellen Shop-Marketer manchmal sehr schwer fallen, den Durchblick im „Kanalâ€Dschungel“ zu behalten. Auf die Definition des richtigen Kanal-Mixes folgt also immer die Auswahl der geeigneten Vermarktungspartner. Das große und unüberschaubare Angebot an Vertriebsportalen erschwert diese Auswahl für den Händler.
Der Produktdatenmarketing-Spezialist „Feed Dynamix“ möchte helfen und stellt mit dem Whitepaper „Multichannel Digital“ eigene Praxistipps zur Identifikation der richtigen Vermarktungskanäle vor. #DigiBuzz stellt die sieben Tipps aus dem Whitepaper vor, deren Zusammenspiel bei der individuellen Auswahl der Vertriebskanäle helfen können.
Marktübersicht der Vertriebskanäle für Online-Shops. Quelle: Feed Dynamix.
7 Tipps für die richtige Vermarktungsstrategie von Online-Shops
Die Portallandschaft für Digital Commerce ist stark fragmentiert. Der Mangel an verfügbaren Daten, Statistiken zu Marktanteilen und Kanalperformances sowie fehlende Transparenz und fehlende Standards erschweren diese Entwicklung umso mehr. Marketers sind gefordert, ihre eigenen individuellen Bedürfnisse zu artikulieren und daraus den optimalen Vermarktungsmix abzuleiten. Den ausführlichen Leitfaden über die richtige Zusammenstellung der Vermarktungskanäle stellt Feed Dynamix in dem Whitepaper kostenlos zur Verfügung.
7 Tipps zur Conversion Optimierung beim A/B-Testing von Websites und Online-Shops
Digital Commerce, SEM / SEOWer seine Website nicht regelmäßig pflegt, verliert auf lange Sicht hin Kunden und Nutzer. Nach Einschätzung des Controlling- und Targeting-Anbieter etracker sollten Optimierungsmaßnahmen jedoch nie ohne vorheriges A/B-Testing durchgeführt werden. Trotz der simplen Idee, die Besucher mit verschiedenen Online-Präsenzen als Testkaninchen einzusetzen, können einige Fallstricke das Vorhaben schnell zum Scheitern verurteilen.
Nicht wild drauf los testen. Beim A/B-Testing gilt immer die Reihenfolge „Problem, Hypothese, Testing“. Quelle: etracker.
Fakt ist, dass Optimierungen an Website oder Onlnie-Shop nicht als eine einmalige Nummer, sondern als eine kontinuierliche Aufgabe verstanden werden darf. Die richtigen Analysen respektive das entsprechende A/B-Testing helfen dabei, sich nur für die erfolgversprechenden Maßnahmen zu entscheiden.
Digitale Preisschilder: Einzelhandel kann von intelligent vernetzten Displays profitieren
Digital Commerce, Marketing, MobileDie Digitale Transformation kommt immer näher auf den Einzelhandel zu. Das Papierpreisschild hat mittlerweile ausgedient. Die Zukunft hingegen gehört Electronic Shelf Label (ESL), mit denen ähnlich wie im Online-Handel individuelle Preisanpassungen vorgenommen werden können. Die intelligent vernetzten Displays nutzen Real Time Pricing ähnlich wie im Online-Handel, so dass in Echtzeit auf Nachfrageschwankungen reagiert werden kann. Zu diesem Schluss kommt eine aktuelle Untersuchung der Managementberatung Mücke, Sturm & Company.
Meist werden Fashion-Artikel in Modegeschäften mit Bändseln ausgestattet, auf denen die Preise kleben. In großen Kaufhäusern prangert die Preisauszeichnung an der Schiene vor dem Regal. Wie ein Blick in die Geschäfte schnell zeigt, finden sich selbst bei Rewe, Penny, Netto, Real oder Edeka nur ausgedruckte Preise. Alles wie gehabt, möchte man meinen. Doch immerhin setzt die Metro als B2B-Großhändler bereits Displays zur Preisauszeichnung ein – und damit als einer der wenigen Händler überhaupt. Der stationäre Einzelhandel könnte den digitalen Wandel sichtbar mit ESL-Displays einleiten und Chancen gegenüber seinen Wettbewerbern ergreifen, die sich zwar nicht adhoc im Ergebnis bemerkbar machen, aber dennoch klare Vorteile für den Warenabsatz schaffen.
„Die Chancen für die Händler sind enorm, denn jede Preisoptimierung führt direkt zu einer Erhöhung der in der Regel bescheidenen Margen“, erklärt Achim Himmelreich, Partner bei Mücke, Sturm & Company. Indem ESL-Displays mit Warenwirtschaftssystemen und Kunden-Devices vernetzt werden, ergeben sich vier völlig neue Optionen für die Verkaufsförderung.
Achim Himmelreich, Partner bei Mücke, Sturm & Company. Foto: Unternehmen
Vier Anwendungsszenarien für Digitale Preisschilder
Gewiss bedeuten diese vier Szenarien noch etwas Zukunftsmusik, jedoch sprechen die Vorteile für eine schnelle Adaption in das jeweilige Ladenkonzept. Zudem wirken sich die günstigen Unterhaltskosten nach Ansicht von Mücke, Sturm & Company im Sinne der Amortisierung positiv aus, die digitalen Preisschilder sind schnell und einfach aktualisierbar – und bieten dabei wesentlich individuellere Möglichkeiten in der Gestaltung als einfache Papierpreisschilder. Je größer die Fläche zur Darstellung, desto schneller kommt die Frage nach „lauten“ Gestaltungskonzepten, so dass ein digitales Preisschild schnell zum digitalen Marktschreier aufsteigen kann. Die Auswirkungen auf das Einkaufsverhalten sowie auf Angebot und Nachfrage gilt es in einem aktuellen Case zu messen – nur wer von den großen oder kleinen Händlern möchte dort als Paradebeispiel und Vorreiter gelten?